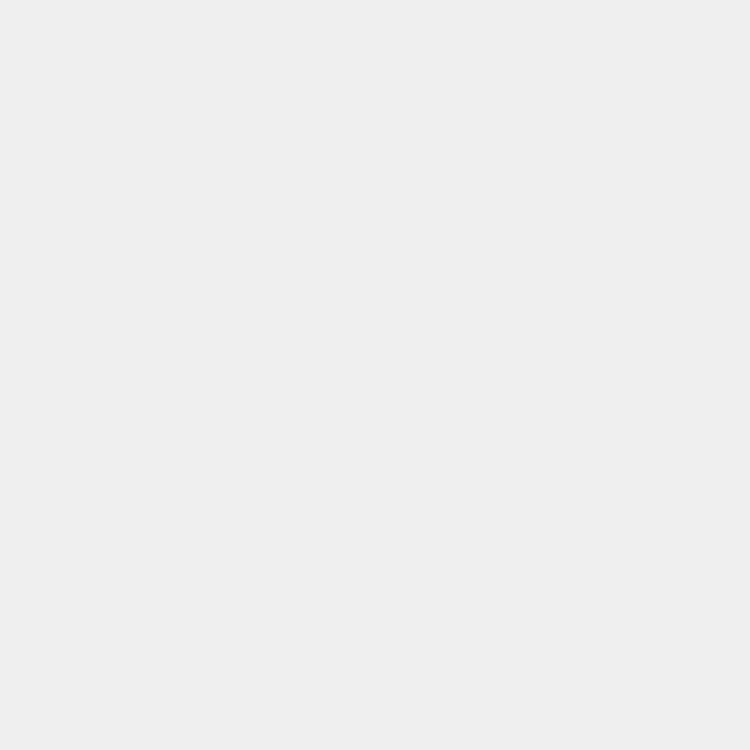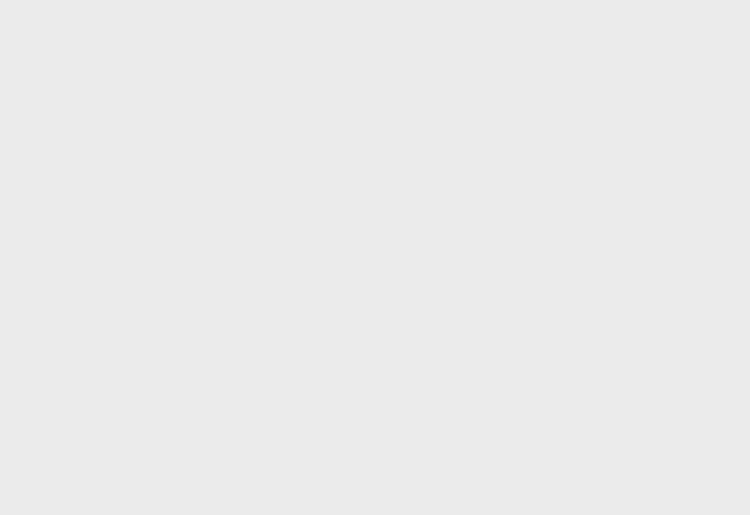Egon Schiele, Erwin Dominik Osen als Akt mit überkreuzten Armen, 1910 © Leopold Museum, Wien Foto: Leopold Museum, Wien/ Manfred Thumberger
16.04.2021 – 26.09.2021
The Body Electric
Erwin Osen – Egon Schiele
The Body Electric
ERWIN OSEN – EGON SCHIELE
Die Ausstellung baut auf einer Serie von kürzlich entdeckten Zeichnungen des österreichischen Künstlers Erwin Osen (1891–1970) auf, eines Freundes von Egon Schiele (1890–1918). Sie wurden mit ziemlicher Sicherheit von Stefan Jellinek (1871–1968), einem Wiener Arzt, der sich auf die Wirkungen von elektrischem Strom auf den Körper spezialisiert hatte, in Auftrag gegeben. Nach ihrem Ankauf durch das Leopold Museum von den Erben Jellineks werden sie hier erstmals öffentlich präsentiert.
Die empathischen Zeichnungen männlicher Figuren entstanden während des Ersten Weltkrieges im Garnisonsspital II in Wien, wo Jellinek Soldaten mit „Kriegsneurosen“ behandelte – heute würde man es posttraumatische Belastungsstörungen nennen. Osen, dessen chronische Neurasthenie oder „Nervenschwäche“ sich durch Grundausbildung und Militärdienst verschlimmert hatte, war in der ersten Jahreshälfte 1915 selbst Patient auf Jellineks Station; seine währenddessen und danach entstandenen Zeichnungen von Soldatenkameraden wurden von diesem aufbewahrt.
Elektrotherapie wurde im Ersten Weltkrieg weithin zur Behandlung von Soldaten verwendet, die Symptome wie Muskelzittern, Lähmungen und Kontraktionen von Gliedmaßen zeigten. Üblicherweise wurden dafür Elektroden an empfindlichen Körperstellen angebracht – Nacken, Ohren, Hoden oder Zehen –, um Stromschläge unterschiedlicher Stärke zu verabreichen. Die Schocks sollten die motorischen Symptome beheben und zugleich den enervierenden Effekten von „Kriegsneurosen“ entgegenwirken. Das Erlebnis des Schmerzes werde, so glaubte man, den Soldaten den Willen zur Gesundung und damit zur Rückkehr in den Dienst einflößen. Die Behandlung, für die es keine Einwilligung brauchte, war bald heftig umstritten. Im republikanischen Nachkriegswien gerieten Ärzte dafür zunehmend unter Rechtfertigungsdruck.
Osens feinfühlige Zeichnungen von Soldaten, die wohl elektrotherapeutisch behandelt wurden, betonen deren Verletzlichkeit und Menschlichkeit. Sie geben uns Einblick in die Militärmedizin zu Kriegszeiten und bieten zudem einen neuen Blick auf die Kunst in Wien um 1900, indem sie die Bedeutung von klinischen Einrichtungen für die Entwicklung von Porträtkunst und Figurendarstellung der Moderne deutlich machen. Egon Schiele hatte im Jahr 1910 in ähnlicher Weise in einem Krankenhaus an Darstellungen von Patientinnen der Entbindungsstation und von Neugeborenen gearbeitet. Die Ausstellung kontextualisiert Osens Porträts von Patienten mit Schieles Werken aus jener Zeit und reflektiert über ihren jeweiligen Beitrag zu einer „klinischen Moderne“.
In seinem berühmten Gedicht I Sing the Body Electric feiert Walt Whitman (1819–1892) unsere Körperlichkeit als unsere Psyche. Er ruft sich selbst zur Begegnung mit den Körpern derer auf, die er liebt, um „sie aufzuladen mit der Ladung der Seele“. Whitmans Text präfiguriert das gemeinsame Interesse von Osen und Schiele am Körper als Subjekt – als jenes Mittel, durch das wir uns selbst und unsere Beziehungen zu anderen verstehen.
Kuratorinnen: Gemma Blackshaw, Verena Gamper
“I sing the body electric,
The armies of those I love engirth me and I engirth them,
They will not let me off till I go with them, respond to them,
And discorrupt them, and charge them full with the charge of the soul.“
Walt Whitman, Leaves of Grass, 1855
Stefan Jellineks elektropathologische Sammlung
Die Elektrizität war Ende des 19. Jahrhunderts die gefeierte „Zauberkraft“ der Moderne, Strom bewegte Maschinen, beleuchtete Straßen und veränderte auch die privaten Lebensbereiche. Neben allen Annehmlichkeiten barg er jedoch auch ein großes Gefahrenpotenzial. Der Mediziner Stefan Jellinek widmete sich ab den späten 1890er-Jahren der Pathologie durch Stromunfall, eine durch die zunehmende Elektrifizierung stark verbreitete Verletzungsursache. Sein Fokus lag sowohl auf Dokumentation und Behandlung wie auch auf Prävention, sein Ansatz war von Beginn an multidisziplinär und auf internationale Vernetzung ausgerichtet. 1903 begründete Jellinek mit seiner Publikation Elektropathologie eine neue Forschungsrichtung. In den folgenden Jahren baute er eine Sammlung zu Stromunfällen auf, die Objekte, Präparate, Moulagen, Zeichnungen und Fotografien umfasste und die er erstmals auf der Allgemeinen Hygienischen Ausstellung 1906 in Wien präsentierte. Seine Forschung machte er durch eine intensive Vortrags- und Publikationstätigkeit bekannt. Die Sammlung selbst war im Rahmen von Führungen am Allgemeinen Krankenhaus zugänglich und wurde 1936 als Elektropathologisches Museum unter der Leitung ihres Gründers institutionalisiert. Kurz nach dem „Anschluss“ wurde Jellinek entlassen, seiner Sammlung beraubt und 1939 zur Emigration nach England gezwungen.
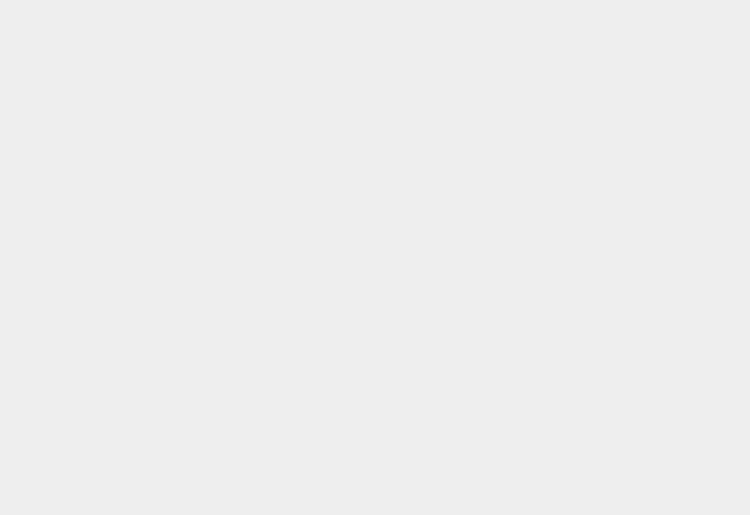 Josef Heu, "Brandwunden und Metall- u. Russimprägnierung der Haut durch elektrischen Kurzschluss am 21.5.1917. Garnisons-Spital Nr. 2.", 1917 © Josef Heu/Technisches Museum Wien
Josef Heu, "Brandwunden und Metall- u. Russimprägnierung der Haut durch elektrischen Kurzschluss am 21.5.1917. Garnisons-Spital Nr. 2.", 1917 © Josef Heu/Technisches Museum Wien
Die präsentierte Auswahl von Zeichnungen, Fotografien und Schautafeln stammt mehrheitlich aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Der Elektrizität wurden kriegsbedingt neue Einsatzfelder erschlossen: Neben Nachrichtentechnik und Beleuchtungsanlagen waren das unter anderem Hochspannungshindernisse zur Grenzsicherung. Mangelnde Erfahrung mit der noch neuen Technik führte häufig zu Versehrungen. Solche Verletzungen dokumentierte Jellinek für seine Sammlung, um sie der wissenschaftlichen Forschung zugänglich zu machen. Er bediente sich dabei sowohl der Fotografie als auch der Zeichnung, der er – wohl wegen ihres interpretierenden Charakters – den Vorzug gab. Seine Sammlung verfolgte nicht den musealen Zweck des Bewahrens und Präsentierens, sondern ist als Laboratorium zur Herstellung und Klassifizierung von elektropathologischem Wissen zu verstehen.
Neben der Dokumentation von Stromunfällen und dem Sammeln von aussagekräftigen Objekten und Bildern befasste sich Jellinek auch mit der therapeutischen Kraft der Elektrizität. 1906 publizierte er das Standardwerk Medizinische Anwendungen der Elektrizität, das einen Überblick über alle medizinischen Anwendungsmöglichkeiten von Strom gab. Als Leiter der neurologischen Abteilung am Garnisonsspital II entwickelte er verschiedenste mechanische Apparaturen zur Heilung der Patienten. Daneben setzte er elektrischen Strom als ebenso gängige wie umstrittene Form der Kriegsneurosentherapie ein, behandelte damit also die neurologischen und psychischen Verletzungen, die viele Soldaten im Krieg erlitten. Solche Methoden waren im Ersten Weltkrieg keineswegs medizinisches Neuland, denn bereits im Sardinischen Krieg 1859 war Strom in der österreichischen Militärmedizin therapeutisch angewandt worden. Zum einen glaubte man, die Soldaten durch die Behandlung wieder einsatzfähig machen zu können, zum anderen wollte man damit vermeintliche Simulanten von tatsächlich Kranken unterscheiden. Schließlich entband eine – wenn auch nur kurzfristige – Heilung des Patienten die Regierung von der Zahlung einer Invalidenrente, zu der sie bei völliger Erwerbsunfähigkeit des Kriegsgeschädigten verpflichtet gewesen wäre.
Erwin Osens Zeichnungen aus dem Garnisonsspital
Osen schuf die Serie von neun Zeichnungen von Patienten der Neurologie in der ersten Jahreshälfte 1915. Die Bilder sind quälend: nackte und verstörte Männer, Männer mit Muskelkontraktionen, Männer mit Schädeldeformationen und eingefallenen Gesichtern. Sie stehen oder sitzen, isoliert, um reine Objekte des medizinischen Blickes zu werden. Wenn überhaupt, gibt es nur minimale Bezüge zur Krankenhausumgebung; Osens Modernismus liegt darin, alle Hinweise darauf zu tilgen. Stattdessen wird die klinische Begegnung, welche die Zeichnungen bezeugen, durch sein Augenmerk auf versehrte Körperteile und durch Mehrfachansichten ein und derselben Person angedeutet, eine Methode, die die Anwesenheit eines untersuchenden Arztes suggeriert.
Wir wissen nicht, wie es zur Entstehung dieser Zeichnungen kam. Mediziner als Mäzene waren Teil des kulturellen Lebens in Wien um 1900, unter anderem beauftragten Ärzt*innen Künstler*innen mit Darstellungen der von ihnen behandelten Patient*innen. Osen hatte schon aus der Zeit vor dem Krieg Erfahrung mit solchen Projekten, wovon Stefan Jellinek aller Wahrscheinlichkeit nach wusste. Die im Garnisonsspital II entstandenen Zeichnungen sind jedoch insofern ungewöhnlich, als der Künstler in diesem Fall auch selbst Patient war. Osen wurde 1915 zweimal an der Klinik behandelt, vom 9. März bis 20. April sowie vom 4. bis 21. Juni; anschließend wurde er für den aktiven Dienst dauerhaft untauglich geschrieben. Zwei der Zeichnungen sind datiert und belegen, dass die Serie während Osens erster Zeit als Patient begonnen und während der Behandlungspause Ende April fortgesetzt wurde. Handelte es sich um einen Auftrag Jellineks, da er von Osens früher entstandenen Patientenporträts Kenntnis hatte? Waren die Zeichnungen womöglich als Teil seines eigenen Rehabilitationsprogrammes gedacht? Solche letztlich nicht beantwortbaren Fragen lassen die Komplexität jener Beziehungsgeflechte erahnen, die zwischen Ärzt*innen, Künstler*innen und Patient*innen im Wien des frühen 20. Jahrhunderts bestanden.
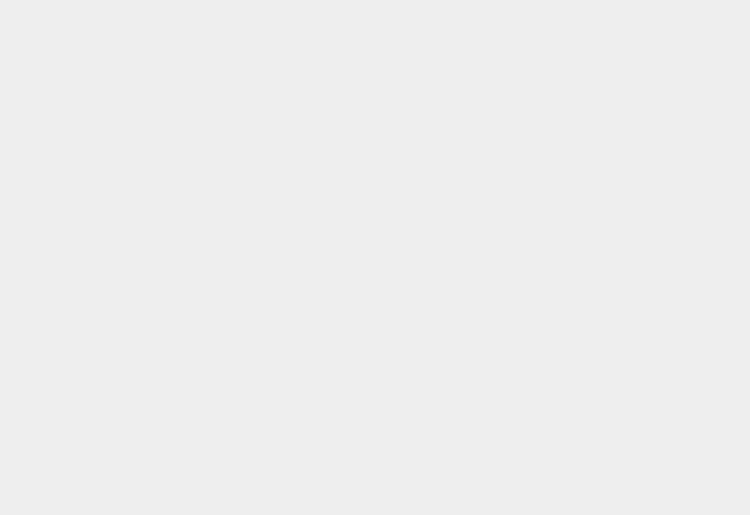 Erwin Dominik Osen, Porträt eines Patienten ("Bruno Granichstaedten"), 26.4.1915 © Leopold Museum, Wien, Foto: Leopold Museum, Wien/Manfred Thumberger
Erwin Dominik Osen, Porträt eines Patienten ("Bruno Granichstaedten"), 26.4.1915 © Leopold Museum, Wien, Foto: Leopold Museum, Wien/Manfred Thumberger
Erwin Osen, Porträt eines Patienten (“Bruno Granichstaedten”), 1915
Der Operettenkomponist Bruno Granichstaedten (1879–1944) wurde am 26. April 1915 porträtiert. Er war so berühmt, dass er selbst das Bild signierte – eine Tatsache, die die Aufmerksamkeit auf Osens sorgfältige, individualisierende Studien der Patienten als Menschen lenkt. Granichstaedtens erster großer Erfolg in Wien war die nostalgische Operette Auf Befehl der Kaiserin. In den idealisierten sorgenfreien Tagen der Regentschaft von Kaiser Franz Joseph I. spielend, zog sie ein vom Krieg geprüftes Publikum in ihren Bann, als sie am 20. März 1915 im Theater an der Wien uraufgeführt wurde. Vier Wochen später, am 20. April, wurde Granichstaedten mit „Neurasthenie mittelstarken Grades“ ins Spital eingewiesen, und zwar genau am Tag von Osens erster Entlassung. In den Aufnahmeunterlagen schreibt Jellinek über ihn, er leide an „hochgradiger Nervosität“, Krämpfen, Augenflackern, häufigen Kopfschmerzen und Schwindel. Weitere Notizen führen einen wahrscheinlich angeborenen „stark sagittal zusammengedrückten“ Kopf an, den Osens Profilporträt noch hervorhob. Die Aufzeichnungen enthalten auch Bemerkungen über Granichstaedtens „Hypalgesie“ oder verminderte Schmerzempfindlichkeit in der rechten Körperhälfte, die möglicherweise durch Anwendung von Stromstößen überprüft wurde. Am 3. Mai wurde Granichstaedten entlassen und für „diensttauglich“ erklärt.
Erwin Osen, Porträt eines*r Patienten*in („Lustknabe“), 1915
Der aus dem 19. Jahrhundert stammende Begriff Neurasthenie oder „Nervenschwäche“ stand häufig im Zusammenhang mit Diskursen über die Verweichlichung von Männern. Der Erste Weltkrieg gab einen neuen Anstoß zur Verbindung von Nervenstärke mit heterosexueller männlicher Kraft. Armeen versuchten, im Kontext von Militarisierung und Nationalinteresse eine „maskuline“ sexuelle Identität durchzusetzen; Homosexualität und Transsexualität wurden nicht toleriert. Wir kennen den Namen dieses Soldaten nicht, was es schwierig macht, ihn/sie im Archiv aufzuspüren und festzustellen, weswegen er/sie im Krankenhaus war. Die Darstellung als „Lustknabe“, wie Osen es auf dem Blatt bezeichnet, ein Junge, der beim Geschlechtsverkehr den empfangenden Part abgab, macht es sehr wahrscheinlich, dass er/sie von der Armee ausgeschlossen, pathologisiert und als „invertiert“ behandelt wurde.
Der nackte haarlose Körper ist theatralisch in Pose gesetzt. Er/Sie trägt Schmuck und Make-up; Finger spielen mit Brustwarzen; überkreuzte Beine verdecken das Geschlechtsteil. Das Haar ist kurz geschnitten, doch Osen sorgt für eine andere, vollere, femininere Frisur durch eine Kopfbedeckung, die über den zurückweichenden Haaransatz reicht. Wollte der Soldat auf diese Weise dargestellt werden? Oder war dies ein Detail, das Osen hinzufügte, um das Geschlecht noch mehr zu verunklaren? Fragen der Autorschaft stellen sich auch im Hinblick auf die unwahrscheinliche Ansammlung von leuchtend bunten Kissen rund um die dargestellte Person, die wohl eine Erfindung waren. Sie scheinen klinische Gerätschaften zu verdecken oder zu ersetzen und verwandeln die Krankenhausumgebung in etwas gänzlich anderes – etwas Queeres. Wie wurden solche formalen Entscheidungen getroffen? Wir wissen es nicht, können jedoch festhalten, dass der „Lustknabe“ Gelegenheit für eine völlig andere, experimentellere Antwort auf die Abbildungsfrage bot. Mit ihren Farben, ihrer Dynamik, ihren Zweideutigkeiten und Eigenheiten widersetzt sich die Zeichnung dem allumfassenden Regime der Klinik, die ihr Entstehen erst ermöglichte.
Erwin Osens Porträt eines Patienten mit schwarzem Umhang, 1915
Vermutlich wurden die Zeichnungen aus dem Garnisonsspital von Stefan Jellinek für Zwecke der medizinischen Forschung und ihrer Verbreitung in Auftrag gegeben. Dabei handelte es sich um eine in Wien wie in ganz Europa übliche Praxis. Adolf Kronfeld (1861–1938) verwendete jene Zeichnungen, die Osen 1913 von Steinhof-Patienten für ihn anfertigte, zur Bebilderung eines öffentlichen Vortrags. Während Fotografien zur Dokumentation von Patient*innen genutzt wurden, glaubte man, dass Porträtzeichnungen noch etwas anderes, schwerer Fassbares einfangen konnten – eine Stimmung, die dem objektivierenden Blick der Kamera entging und die ihren „wahren“ Zustand vermittelte. Jene Ärzte, die der Avantgarde verbundene modernistische Künstler engagierten, behaupteten gern, ihre Aufträge seien ein Beweis für die Progressivität ihres Behandlungsansatzes und ihrer Einstellung zur Menschheit generell.
Mitfühlende Künstler hielten sich oft nicht an die illustrativen Vorgaben medizinischer Aufträge; stattdessen rückten sie, wie Osen, das Erleben des Patienten in den Vordergrund und problematisierten den Begriff des distanzierten klinischen Blickes in prononciert experimentellen und genreübergreifenden Bildern. In dieser Zeichnung eines stehenden Patienten im Profil, nackt bis auf eine um den Kopf gewickelte und am Hals festgebundene Bandage, weicht Osen vom Standard ab und allegorisiert sein Modell geradezu – eine beunruhigende Transformation. In voller Größe dargestellt, hebt der bleiche und aufgeblähte Körper des Patienten sich gegen einen schwarzen Grund ab, der an die Gestalt einer anderen größeren Figur in Umhang und Kapuze erinnert, den „Sensenmann“, die Personifikation des Todes.
Erwin Osens Porträts von Patienten der Klinik Am Steinhof, 1913
Osen und Schiele standen beide in Verbindung mit Dr. Adolf Kronfeld (1861–1938), einem Sammler von Arbeiten beider Künstler, der sich sehr für das Verhältnis von Kunst und Medizin interessierte, darüber Vorträge hielt und publizierte. 1913 berichtete Osen in einem Brief an Schiele über eine Serie von Zeichnungen von Patienten, die Kronfeld ihn gebeten hatte im Wiener psychiatrischen Krankenhaus Am Steinhof anzufertigen. Sie sollten als Begleitmaterial für einen Vortrag dienen, den dieser dort am Naturforschertag über den „pathologischen Ausdruck im Porträt“ halten wollte. Aus dem Auftrag entstanden zumindest zwölf Zeichnungen, von denen zwei hier zu sehen sind. Die Dargestellten werden auf ihren jeweiligen Blättern als Karl Kulnik und Oskar Löwy identifiziert; ihre beigefügten Patientennummern datieren ihre Einweisung in die Klinik Am Steinhof auf 1911 beziehungsweise 1913. Osens Porträts, die Jellinek durchaus gesehen haben könnte, sind ein Vorgriff auf seine Arbeiten am Garnisonsspital. Seine Strichführung mag hier noch nicht so ausgereift sein, doch der fesselnde Kontrast zwischen seinem Augenmerk auf das Gesicht und der bloßen Andeutung des Körpers ist ein Hinweis auf das Kommende.
Erwin Osen, Selbstporträt, 1915
Dieses Selbstporträt Osens in Militäruniform entstand am 2. April 1915, in der vierten Woche seines ersten Aufenthalts im Garnisonsspital. Er stellt sich selbst anders dar als jene Soldaten, die er fast zur gleichen Zeit porträtierte; sein Strich, mit dem er Gesicht und Oberkörper festhält, ist expressiver und suggestiver. Auf dem Blatt selbst gibt es keinen Hinweis auf das Krankenhaus, als Entstehungsort der Zeichnung wird Wien genannt. Osen gibt sich auch mehr Mühe mit seiner Signatur, die er in typisch modernistischer Manier mit Datum und Jahr in eine Quadratform einschreibt, was das Blatt als Kunstwerk kenntlich macht. Durch diese Details weist Osen sich nicht als Patient, sondern zuallererst als Künstler aus.
Interessant ist, dass er sich selbst auf eine Weise darstellt, die erkennbar Schiele nachempfunden ist. Die gefurchte Stirn, der markante Haaransatz, die eckigen Schultern und die stark betonte rechte Hand mit den ausdrucksvoll gespreizten Fingern verdanken sich Schieles Experimenten der Selbstdarstellung, insbesondere zwischen 1910 und 1913, als die beiden Künstler sich am nächsten standen. Auch das doppelte Selbstporträt gehörte zu Schieles damaliger Praxis, nimmt jedoch bei Osen im Kontext seines Krankenhausaufenthaltes aufgrund diagnostizierter schwerer Neurasthenie, zu deren Symptomen auch ein „Facialis-Tic“, ein Muskelzucken im Gesicht, zählte, eine neue Bedeutung an. Schieles Doppelselbstporträts – Bilder eines gespaltenen, konfliktgeplagten Ichs – waren ihrem Wesen nach performativ. Osens Selbstporträt, entstanden während einer Behandlungsphase in einer neurologischen Abteilung, legt die Komplexität dieser Darstellungen offen, die sich auf das Inbild des verunsicherten Individuums bezogen und jenes zugleich entwickelten.
Egon Schiele, "Kranker Russe", 1915
Anders als vielen seiner Künstlerkollegen blieb Egon Schiele im Ersten Weltkrieg anfangs der Militärdienst aufgrund eines angeborenen Herzleidens erspart. Im Frühjahr 1915 wurde er jedoch als heerestauglich eingestuft und kurz nach seiner Heirat mit Edith Harms (1893–1918) zur Grundausbildung ins böhmische Neuhaus (Jindřichův Hradec) geschickt. Mit dem Eintritt ins Militär ging auch die Einbindung in ein soziales Gefüge einher, das in starkem Kontrast zu Schieles wiederholter Selbstisolation der frühen Jahre stand. Von Anfang an versuchte er, mithilfe einflussreicher Unterstützer ins Kriegspressequartier in Wien versetzt zu werden. Stattdessen wurde er beim Bau der städtischen Verteidigungsanlagen und als Wache für den Transport russischer Kriegsgefangener zwischen Gänserndorf und Wien eingesetzt. In der zweiten Jahreshälfte 1915 und auch im Folgejahr während seines Dienstes im Kriegsgefangenenlager im niederösterreichischen Mühling entstand eine Reihe von einprägsamen Porträts dieser Gefangenen. Von Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit gezeichnet, sind sie den Mechanismen der Institution Gefangenenlager unterworfen – ein Machtregime, das in seiner Struktur jenem von medizinischen Einrichtungen für verwundete Soldaten vergleichbar ist.
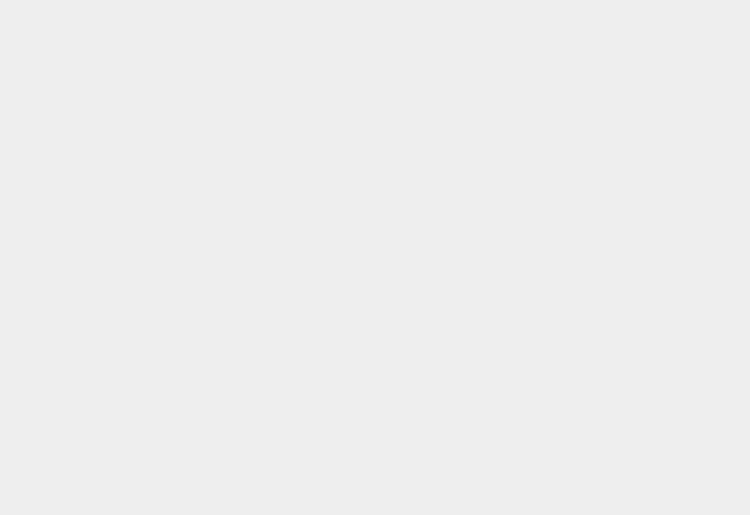 Egon Schiele, "Kranker Russe", 1915 © Leopold Museum, Wien, Foto: Leopold Museum, Wien/Manfred Thumberger
Egon Schiele, "Kranker Russe", 1915 © Leopold Museum, Wien, Foto: Leopold Museum, Wien/Manfred Thumberger
Egon Schiele, Halbakt (Selbstdarstellung), 1911 © Leopold Museum, Wien Foto: Leopold Museum, Wien/Manfred Thumberger
Der Körper im Blickpunkt
Egon Schieles Werk und Leben werden seit Jahrzehnten intensiv und international beforscht, seine Kunst wurde zum Inbegriff der dissonanten Seite der österreichischen Moderne. Demgegenüber ranken sich um den fast gleichaltrigen Erwin Osen Fiktionen und Gerüchte, sein bildnerisches Œuvre blieb weitgehend unbeachtet und ist teils verschollen. Die Geschichte der Freundschaft dieser beiden Künstler, die sich über mindestens fünf Jahre erstreckte und Höhen und Tiefen kannte, muss demnach mit sehr unterschiedlicher Quellenlage und in kritischer Reflexion jenes abwertenden Bildes erzählt werden, das Arthur Roessler (1877–1955) 1922 in seinen Erinnerungen an Egon Schiele von dessen „Begegnung mit dem Abenteurer“ zeichnete.
Die beiden Künstler lernten sich spätestens im Frühsommer 1909 kennen, als Schiele sein Studium an der Akademie frühzeitig beendete und gemeinsam mit Gleichgesinnten – darunter der „Maler für Theater-Kunst“ Erwin Osen – die Neukunstgruppe gründete. Einen frühen Höhepunkt erlebte die Freundschaft im Sommer 1910, den die beiden gemeinsam in Krumau (Český Krumlov) verbrachten. Diese Erfahrung ist hinsichtlich ihres Niederschlags in Schieles bildnerischem wie auch lyrischem Schaffen nicht hoch genug einzuschätzen. Seine intensive Auseinandersetzung mit dem männlichen Körper und Fragen der sexuellen Identität, die sich in zahlreichen Akten und zum Teil dezidiert androgynen Selbstakten äußerte, mag sich am extrovertierten „Mimen van Osen“ entzündet haben oder von ihm befeuert worden sein. Osen war weit mehr als nur ein Mitbewohner oder ein zeitweiliges Modell: Er kann als Impulsgeber für die Vitalisierung des Körpers in Schieles Kunst angesehen werden, die entscheidend war für die Neubewertung des Körpers als Medium und, wichtiger noch, um seiner selbst willen.
Dieses Interesse am Körper als Ausdrucksträger war nicht singulär, Physis und Psyche erfuhren in der Zeit um 1900 vor allem in Wien eine künstlerische und wissenschaftliche Zuwendung von nie da gewesener Intensität. Manche Werke entstanden an der Schnittstelle zwischen künstlerischen und medizinischen Fragen, manche wurden durch persönliche Kontakte zu Ärzt*innen, die Zugang zu medizinischen Einrichtungen gewährten, überhaupt erst ermöglicht. Solchen Bildern von Körpern ist ihre Entstehung im medizinischen Kontext eingeschrieben, was nicht nur den Blick auf diese Werke verändert, sondern mit den aufgeworfenen Fragen zu Blickregime und Objektifizierung auch auf andere Darstellungen von Körpern ausstrahlt.
Egon Schieles Darstellungen des "Mimen van Osen", 1910
In seinen Erinnerungen an Egon Schiele widmete Arthur Roessler dem „Abenteurer“ Erwin Osen ein ganzes Kapitel und beschrieb ihn als „hochgewachsen, schlank, hager wie ein Araber, mit dem blassen und bartlosen Gesicht eines ‚gefallenen Engels‘“, er gleiche „der Figur des ‚Helden‘ in einem aufregenden Filmschauspiel“ und „Kinodramatik“ umwittere „seine trainierte Gestalt“. Zu seiner „augenscheinlich virtuosen mimischen Ausdrucksfähigkeit“ geselle sich „der nicht minder gewandte Wortausdruck der leicht spielenden Phantasie des geborenen Improvisators“. Das Aufeinandertreffen dieses exaltierten Mannes mit dem von Zeitzeugen als schüchtern beschriebenen Schiele blieb nicht ohne Folgen, von Osen und seiner Gefährtin Moa Mandu sei Schiele „ganz und gar berückt“ gewesen, „und zwar von dem Manne noch mehr als von dem Mädchen“. Mit den 1910 entstandenen Porträts des „Mimen van Osen“ in exaltierter Gestik und Mimik schuf Schiele einige seiner einprägsamsten Inszenierungen körperlichen Ausdrucksvermögens, die wegweisend für seine Variante des Expressionismus sein sollten.
Egon Schieles und Erwin Osens Darstellungen von Fuchsien
Im Mai 1910 übersiedelten Egon Schiele und Erwin Osen nach Krumau, der Heimatstadt von Schieles Mutter, und verbrachten dort gemeinsam mit Schieles späterem Schwager Anton Peschka (1885-1940) den Sommer. Aus diesem Ort, den sowohl Schiele als auch Osen in den folgenden Jahren wiederholt aufsuchten, stammen von beiden Künstlern in der Motivwahl ähnliche Gemälde und Zeichnungen. Motivisch ähneln sich auch diese beiden Darstellungen blühender Pflanzen, doch in stilistischer Hinsicht könnten Osens Blühende Fuchsie und Schieles "Sonnenbaum" – bei dem es sich ebenfalls um eine Fuchsie handelt – kaum weiter voneinander entfernt sein. Schiele setzt auf ein vibrierendes Nebeneinander von kraftvollen, kontrastierenden Farbflecken, die vor allem in der Mitte des Blattes beinahe den Gegenstandsbezug verlieren, und ordnet das Motiv der Bilddramaturgie unter. Dahingegen übersetzt Osen minutiös jedes kleinste Detail der Pflanze in eine bewusst unzeitgemäße, registrierende Bildsprache. Schieles kompositorische und koloristische Kühnheit trifft auf Osens zögerlich anmutende Detailgenauigkeit. Diese so augenfällige stilistische Distanz wird den beiden Künstlern auch in den Arbeiten der folgenden Jahre erhalten bleiben.
Egon Schiele, „Moa“, 1911 © Leopold Museum, Wien Foto: Leopold Museum, Wien/Manfred Thumberger
Die Tänzerin Moa Mandu
Durch Schieles Porträts ist die aus Bosnien stammende Tänzerin Moa Mandu in der Kunstgeschichte verewigt, doch die Quellenlage zu ihrer Person ist dürftig. Eine um 1910 entstandene Fotografie zeigt sie mit Osen in darstellerischer Pose. Darüber hinaus wurde sie vereinzelt in Rezensionen erwähnt und spielte 1919 die Rolle der Aischa im Stummfilm Der Hirt von Maria Schnee. Der Mangel an Fakten führte zur Gleichsetzung ihrer Person mit ihren Bühnenfiguren. Die Rolle der „indischen Tänzerin“ in Verbindung mit Arthur Roesslers Beschreibung ihres „Antlitzes einer ägyptischen Prinzessin“ hatte zur Folge, dass sie heute mitunter als dunkelhäutig bezeichnet wird., doch wie eine Fotostrecke in der Zeitschrift La Danse von 1922 belegt, beschränkte sich ihr „exotisches“ Äußeres auf einen etwas dunkleren Teint. 1924 widmete Fernand Divoire der Tänzerin mit der „eher weißen Haut und der ein wenig gekrümmten Eleganz der Pariser Mannequins“ in seinem Buch Découvertes sur la danse ein ganzes Kapitel, bevor sich ihre Spur 1926 in Berlin verlor.
Schieles und Osens Darstellungen der Tänzerin Moa Mandu
Die Tänzerin Moa Mandu, von der man bis auf ihre bosnische Herkunft wenig Konkretes weiß, kam laut Zeitzeugen über Osen in Kontakt mit Schiele. Es entstand eine ganze Reihe von Porträts der Tänzerin, die Schiele mit einem in Versalien neben die Figur gesetzten „MOA“ anders als viele seiner Modelle namentlich identifizierte. Eines der in Komposition und Kolorit gelungensten Porträts befindet sich heute in der Sammlung des Leopold Museums. Der cloisonnéartig abstrahierte Gewandkörper durchmisst fast die gesamte Höhe des Bildraumes, bevor sich der buchstäblich verhüllte Ausdruck des Körpers im Blick der Dargestellten mit voller Wucht entlädt. Arthur Roessler beschrieb die „gleichsam blicklosen, großen, jettdunklen, unter braunblau beschatteten, langbewimperten und überschweren Lidern schwermütig mattschimmernden Augen“ von Osens Gefährtin attributreich als zentralen Aspekt ihrer körperlichen Erscheinung – das untermauert Schiele mit seiner im Blick kulminierenden Darstellung der Porträtierten.
Vergleichbar mit Schieles Darstellung der Moa Mandu legt auch Osen in seinem Porträt den Fokus auf die Ausdrucksstärke des Blickes. Die Tänzerin, deren Körper erst ab der Taille von einem ausladenden Rock bedeckt ist, wendet sich frontal dem Betrachtenden zu und vermittelt eine Mischung aus aggressiver Kühnheit und sexueller Zügellosigkeit. In den 1924 publizierten Découvertes sur la danse wird Mandu für die Entdeckung des Rumpfes Tribut gezollt, den sie durch Verhüllen und Enthüllen zum Protagonisten des Tanzes machte. Osen gelingt ein ungemein ausdrucksstarkes Porträt, das bei aller stilistischen Distanz die Nachbarschaft zu Schieles Darstellung nicht zu scheuen braucht. Durch das Gastspiel von Ruth St. Denis im Wiener Ronacher-Palast im Februar 1908 hierzulande noch verstärkt, wurden Exotik und Mystik ferner Länder – und mit ihnen die Angst vor diesem Fremden – im Bild des „Orientalischen“ eingefangen und im sanktionierten Kontext künstlerischer Darbietung auf die Bühne oder ins Bild gebracht. Indem sie die Tänzerin als Personifikation des Fremden zeigen, folgen Osen und Schiele dieser seit Langem bestehenden Bildtradition.
Egon Schieles Darstellungen von Schwangeren, 1910
Eine Reihe von 1910 entstandenen Studien von erkennbar hochschwangeren Frauen werden in Zusammenhang mit der Wiener II. Frauenklinik gebracht. Anders als Osen bei seinen Darstellungen von Patient*innen vermerkte Schiele weder den Entstehungsort dieser Zeichnungen noch die Namen der Modelle auf dem Blatt. Der zeitliche Zusammenfall dieser Bilder mit einem Brief des Gynäkologen Dr. Erwin von Graff (1878–1952) über Schieles Freundin Liliana Amon (1892–nach 1939), die von Mai bis August 1910 Patientin der Geburtshilfeabteilung war, ist ein Hinweis darauf, dass die Dargestellten Patientinnen der Klinik waren, eine davon womöglich Amon selbst. Die Klinik hatte drei Hauptaufgaben: „Die erste und oberste ist die der Heilung und Pflege kranker Frauen, der Beistandleistung in den schwersten Stunden. Die zweite ist die des Unterrichtes der heranwachsenden Generationen in den einschlägigen Gebieten der Heilkunde. Die dritte Aufgabe ist die der Weiterbildung des Faches, der Erweiterung unseres Wissens und, was damit untrennbar im Zusammenhange steht, unseres Könnens.“ Die Klinik war Teil eines Lehrkrankenhauses, ein herausragendes internationales Forschungszentrum mit hochgerühmter Ausstattung und Technologie. Schiele tilgte diesen klinischen Kontext aus seinen Darstellungen der Frauen. Er wusste um die Macht des negativen Raumes wie um die Präsenz des Abwesenden und stellte daher die modernen, für genaue Untersuchungen von Vulva, Vagina und Uterus konzipierten Untersuchungsstühle nicht dar. Stattdessen werden der klinische Raum und die klinische Begegnung durch die Linien des weiblichen Körpers beschrieben, eines Körpers als Stückwerk, atomisiert, kontrolliert, fixiert.
Egon Schieles Darstellungen von Neugeborenen, 1910
Dies sind Beispiele von sechs bekannten Studien Neugeborener aus der II. Frauenklinik, die vermutlich Darstellungen ein und desselben Kindes sind. Die Klinik hatte 200 Betten auf der Entbindungsstation und 52 Betten für Patientinnen der Gynäkologie. Die Betten verteilten sich auf große offene Säle sowie kleinere Zimmer für ein bis drei Patientinnen. Die Klinik stand allen Frauen quer durch das soziale Spektrum offen, durch die räumliche Organisation ließen sich jedoch sehr wohl Klassenunterschiede feststellen. Ausstattung und technische Möglichkeiten der Klinik standen beispielhaft für die Professionalisierungsprozesse, die zu diesem Zeitpunkt die Macht des Arztes über die weibliche Institution des Hebammentums verfestigten. Diese Prozesse waren mit einem technokratischen Modell von Geburtshilfe verknüpft, das Schwangerschaft und Geburt pathologisierte und diese Erfahrungen vom Heim ins Krankenhaus verlegte. Als Expressionist übertrieb Schiele häufig die Magerkeit der Gliedmaßen seiner Modelle, die Größe des Kopfes im Vergleich zum Körper sowie die Färbung der Haut – lebende Wesen wirkten oft dem Tod nahe. Bei diesem Neugeborenen aber sind die Schwächlichkeit der Arme und Beine sowie die blaue und violette Färbung der Haut besonders ausgeprägt. Außerdem wurden, auch wenn Schiele schnell arbeitete, Neugeborene nicht lange unbedeckt gelassen, insbesondere nach der Abnabelung, die das Ende der Entbindung anzeigte. War dieses Kind tot oder lebendig? Die Stärke der Zeichnungen liegt in ihrer Unbestimmtheit.
Die Mediziner Erwin von Graff und Adolf Kronfeld
Der Assistent des Direktors der II. Frauenklinik, Erwin von Graff (1878–1952), bot Schiele 1910 die Möglichkeit, Schwangere auf dem Untersuchungstisch und Neugeborene unmittelbar nach der Geburt zu zeichnen. Schieles Darstellungen solcher Körper zählen zu seinen einprägsamsten Bildern dieses Jahres, in dem die für ihn so zentrale Reflexion der Verschränkung von Sexualität und Tod in der Figur der Mutter einen frühen Höhepunkt erreichte.
Die II. Frauenklinik lag in unmittelbarer Nähe von Graffs Wohnhaus in der Höfergasse 18, in dem später auch Osen sein Atelier haben sollte. Nachdem die beiden Künstler Anfang Mai 1910 gemeinsam nach Krumau gezogen waren, berichtete Graff in einem Brief an Schiele – in dem er auch Osen grüßen ließ – von einer gewissen L. A., die in die Frauenklinik aufgenommen worden war. Dabei handelte es sich um Liliana Amon (1892– nach 1939), die nachweislich am 17. Mai 1910 (Berufsangabe: Modell) in die II. Frauenklinik kam und dort drei Monate später eine Tochter zur Welt brachte. Jahrzehnte später veröffentlichte die nun in Paris lebende Amon den autobiografischen Roman Barrières, der die Rekonstruktion der Geschichte ermöglicht: Die Hauptfigur Anna Lisser lernt darin – bereits schwanger – den Maler „Egon S…“ kennen, zieht bei ihm ein und steht ihm Modell, bevor ein „docteur Graf“ ihr den Traum von einer gemeinsamen Zukunft mit Schiele dessen künstlerischer Karriere zuliebe ausredet.
Auf eine aus dem Jahr 1915 stammende Liste von Sammler*innen seiner Werke setzte Schiele neben Erwin von Graff unter anderen den Mediziner und Schriftsteller Adolf Kronfeld (1861–1938). Dieser hatte auch ein Studium der Kunstgeschichte absolviert und publizierte zu medizinischen wie kunsthistorischen Themen. Von Schiele wurde Kronfeld erstmals 1911 im Zusammenhang mit dem Erwerb von Zeichnungen erwähnt, während die früheste Verbindung zu Osen ein Gemälde der Stadt Krumau von 1912 ist, das Kronfeld erwarb. 1913 beauftragte Kronfeld Osen, für seinen Vortrag „Zur Pathologie des Porträts: Neurologisches und Psychiatrisches. (Mit Demonstrationen)“, den er bei der 85. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte im September des Jahres in Wien hielt, Porträts von Patienten der psychiatrischen Klinik Am Steinhof anzufertigen, von denen wenigstens zwei erhalten und in der Ausstellung zu sehen sind. Ob Kronfeld versucht hat, auch Schiele für Porträtaufträge dieser Art zu gewinnen, ist weder durch Werke noch durch Korrespondenz belegt.
Erwin Osen und Egon Schiele: Zeugnisse einer Freundschaft
Die biografischen Berührungspunkte zwischen Erwin Osen und Egon Schiele sind für die Jahre 1909 bis 1914 durch verschiedene Quellen belegt, darunter eine nicht umfassende, jedoch über die komplette Zeit laufende Korrespondenz. Während sich von Schiele keine direkt an Osen adressierten Briefe, wohl aber Äußerungen gegenüber Dritten erhalten haben, sandte dieser seinem Künstlerfreund wahlweise in Deutsch oder Englisch verfasste Nachrichten unter anderem aus Athen, Triest, Prag und München. Aus den erhaltenen Zeugnissen geht hervor, dass das Verhältnis der beiden nicht frei von Konflikten war. Tonangebend für das retrospektiv entworfene Bild der Freundschaft zwischen Osen und Schiele war der von Arthur Roessler in seinen Erinnerungen an Egon Schiele 1922 veröffentlichte Vorwurf der Veruntreuung von Werken und Arbeitsrequisiten Schieles im Sommer 1912 sowie der Fälschung von Schiele-Blättern. Neben diesen – so sie der Wahrheit entsprechen – schwerwiegenden Vorkommnissen belegen die erhaltenen Schriftstücke jedoch eine durch gemeinsame Projekte und Reisen und gegenseitige Unterstützung geprägte Freundschaft, die sich über mindestens fünf Jahre erstreckte.
„Hier in Athen ist eine Revolution von seitens des Militärs und des Pöbels, es geht höllisch lustig zu. Mir geht es sehr gut hier, bin schon sehr bekannt und wegen meines Humors beliebt spreche auch schon sehr viel griechisch. Ich bitte Sie so lieb zu sein und mir zu erlauben, dass ich meinen Koffer zu Ihnen stellen darf. Umschiffe den ganzen Pelopones [!] werde Ihnen Karten senden Montag steche ich in See. Mit vielen [!] Dank im voraus u. herzlichsten Grüssen an Alle Ihr dankbarer Quälgeist Osen”
Erwin Osen an Egon Schiele, 12.9.1909
Im Frühjahr 1913 übersiedelte Osen nach München, um am Künstlertheater zu arbeiten. Nach eigenen Aussagen war er dort als Ausstattungsleiter tätig, bisher ist jedoch einzig die Gestaltung des Plakates für die Operette Der Mikado nachweisbar. Der Wegzug aus Wien schlug sich in einer intensiveren Korrespondenz mit Schiele nieder, in der Osen unter anderem in der für ihn typischen exaltierten Manier von den Ausstattungsarbeiten für eine Parsifal-Inszenierung berichtete. Im Dezember 1913 schrieb Schiele an Erich Lederer (1896–1985), er werde am Neujahrstag 1914 zur Premiere in Prag sein, da er es Osen versprochen habe. Vom Januar 1914 stammen die letzten erhaltenen postalischen Grüße Osens – und Moa Mandus – an Schiele. Dass sie auch danach noch (wenn auch lose) freundschaftlich verbunden blieben, wird dadurch belegt, dass Schiele den Kollegen in einer auf 1917/18 zu datierenden Adressliste mit seiner Münchner Adresse anführte. Osen hatte München allerdings schon kurz nach seiner Rückkehr aus der neurastheniebedingten stationären Behandlung im Wiener Garnisonsspital II im August 1915 in Richtung Berlin verlassen, wo er laut Selbstbeschreibung als „Bühnenreformer“ tätig war.
“Verehrlichstes Gesindel! Hochlöbliche Tafelplatte von Caffe und Spekulunke Eichberger. Sehr geehrter Herr und Frau Egon Schiele! Miss ist mir und miss bin ich im goldenen Prag angekommen und gestatte mir die Gedanken in Eure verworfene und verseuchte Peripherie zu schmeissen. Gott! Wo ich so e[in] reiner Mensch bin! Ich hab wahnsinnig viel zu tun, so eine Parsifal Ausstattung ist eine Hurnarbeit ! Gott! Was vor ein böser Mensch bin ich gewesen!”
Erwin Osen an Egon Schiele, Dezember 1913