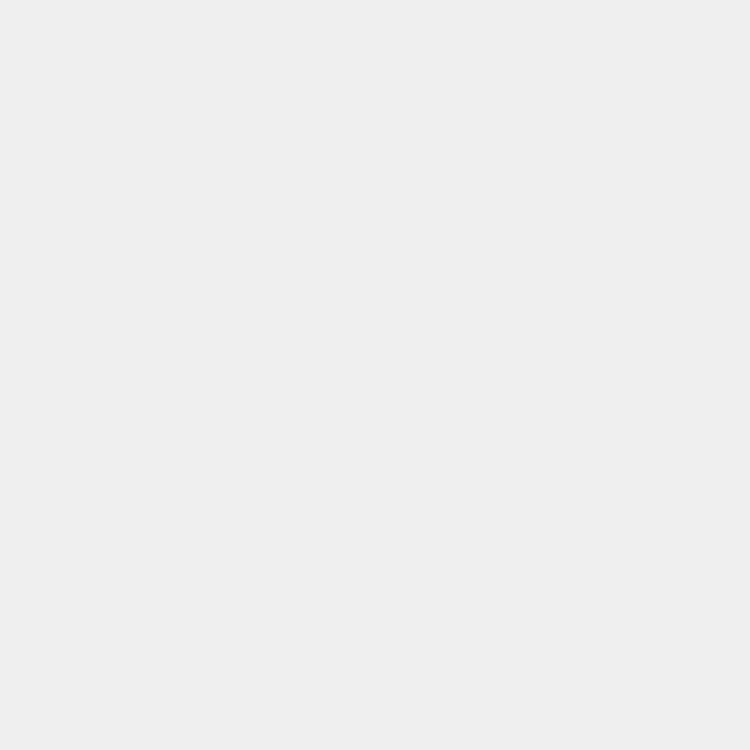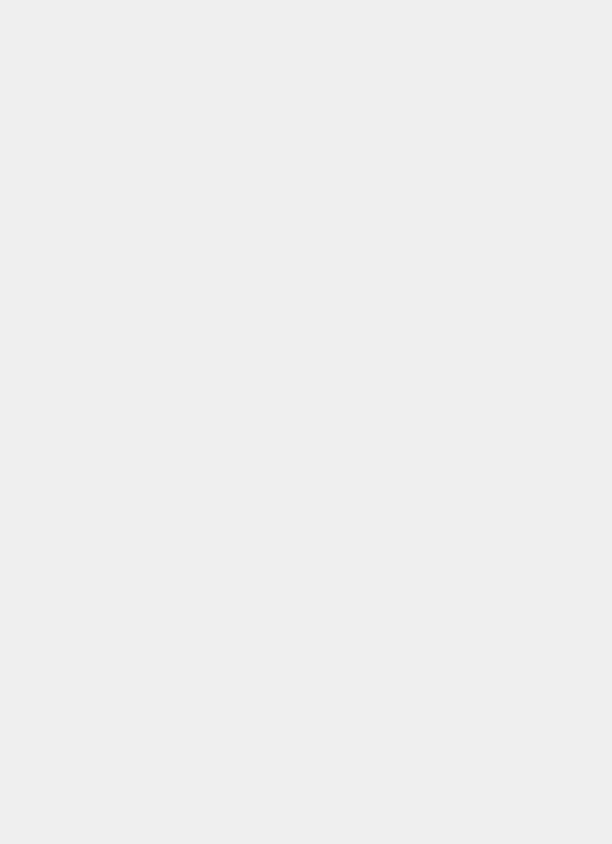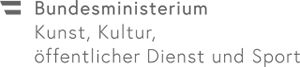Egon Schiele, Sitzende Frau mit hochgezogenem Knie (Detail), 1917 © National Gallery Prague | Foto: National Gallery Prague 2025
28.03.–13.07.2025
EGON SCHIELE
LAST YEARS
„Eine Epoche zeigt der Künstler ein Stück seines Lebens. Und immer durch ein großes Erlebnis im Sein der Künstlerindividualität beginnt eine neue Epoche die kurz oder länger dauert [...].“
Egon Schiele, Manifest der Neukunstgruppe, 1909
EGON SCHIELE. LAST YEARS
In der Mitte einer Karriere, die 1909 begann und kaum zehn Jahre umfasste, nahm das Leben des aus Tulln stammenden Künstlers Egon Schiele (1890–1918) eine dramatische Wendung.
Der Thronfolger des österreichisch-ungarischen Kaiserreiches wurde am 28. Juni 1914 ermordet, und bereits im August befand sich ein großer Teil Europas im Krieg. Im November 1914 heiratete die Lieblingsschwester des Künstlers, Gertrude „Gerti“ (1894–1981), nach einer stürmischen außerehelichen Beziehung dessen Freund und ehemaligen Studienkollegen Anton Peschka (1885–1940). Im gleichen Zeitraum trennte sich Schiele von seiner langjährigen Gefährtin Walburga „Wally“ Neuzil (1884–1917). Kurz bevor er in Prag bzw. Neuhaus in Böhmen einrücken musste, heiratete er am 17. Juni 1915 das zurückhaltende „Mädchen von nebenan“ Edith Harms (1893–1918).
Die Auswirkungen des Krieges und die lebensverändernden Umstände der Ehe machten Schiele empfänglicher für äußere Lebenswirklichkeiten. Seine allegorischen Gemälde wurden universeller und weniger selbstbezogen, seine Porträts empathischer – eine Eigenschaft, die durch einen realistischeren Stil begünstigt wurde.
Egons zunehmende humanistische Ausrichtung zeigte sich zunächst in den Zeichnungen von Edith und weitete sich bald auf andere Motive aus. Der wachsende Erfolg in seinen letzten zwei Lebensjahren ermöglichte es dem Künstler, seine Aktivitäten als Porträtmaler zu intensivieren und groß angelegte Projekte zu planen.
Kurz vor seinem 28. Geburtstag befand er sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere und dachte intensiv darüber nach, wie er die österreichische Kulturszene in der künftigen Nachkriegszeit wiederbeleben könne. Edith und Egon Schiele starben jedoch im Oktober 1918 wenige Tage hintereinander an der Spanischen Grippe. Sie ließen die Geschichte ihrer Ehe unvollendet, so wie auch Schieles künstlerische Laufbahn ein jähes Ende fand. Die Frage, was er noch alles erreichen hätte können, bleibt für immer unbeantwortet.
Das Leopold Museum rückt erstmals explizit das „Spätwerk“ Schieles ab 1914 in den Fokus einer umfassenden monografischen Schau mit rund 130 Werken aus internationalen Museen und Privatsammlungen. Die Ausstellung verwebt biografische und künstlerische Elemente. Dabei greift sie auf zum Teil noch unbekannte Archivalien zurück, wie das bisher unveröffentlichte Tagebuch von Edith Schiele, das im begleitenden Ausstellungskatalog zur Gänze publiziert ist.
Kuratorinnen: Kerstin Jesse, Jane Kallir
Kuratorische Assistenz: Simone Hönigl
Die Suche nach dem Selbst
Die Entschwebung entstand in der ersten Hälfte des Jahres 1915. Von einer folienartigen Landschaft „entschweben“ zwei Gestalten, die untere noch mehr der Erde verhaftet. In diesem Doppelselbstbildnis, das auch den Titel Die Blinden II trägt, ist der Künstler selbst erblindet. Egon, so eine Interpretationsmöglichkeit, nimmt Abschied von seinem früheren Ich, seinem jugendlichen Narzissmus, das „anderen gegenüber blind“ war, während der reifere Schiele, „der auf der Erde zurückbleibt“, „sich selbst gegenüber blind ist“ – noch. Die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Person war in den Zeiten des Umbruchs unausweichlich: Trennung und Vermählung, Weltkrieg und lebensverändernde Folgeerscheinungen forderten von Schiele die Anpassung an völlig neue Verhältnisse und Rollen.
In seinem Werk gab Schiele die radikalen formalen Experimente der Jahre 1910 bis ca. 1913 – insbesondere die auffallend verdrehten Körperstellungen und inszenierten Posen seiner Figuren und Selbstporträts, die teils wilde Gestik sowie grimassierende Physiognomien und die kantigere Linienführung – auf und entwickelte einen realistischeren, von tieferem Einfühlungsvermögen geprägten Stil. Die Linienführung wurde organischer, beruhigter und weniger sprunghaft.
Edith Anna Harms
Die Familie Harms, die neben Edith aus ihrer älteren Schwester Adele und den Eltern Johann und Josefine bestand, zog Anfang 1913 in das Gebäude gegenüber dem Atelier des Künstlers in der Hietzinger Hauptstraße. Die Schwestern wuchsen wohlbehütet auf; beide lernten nähen und kochen und sprachen Englisch und Französisch. Schiele nahm offensichtlich im Januar 1914 zum ersten Mal Kontakt mit den beiden Frauen auf, der sich im Dezember des Jahres intensivierte. Anfang 1915 gestanden Egon und Edith einander ihre Liebe.
Nur drei Tage nach der Hochzeit und kurzen Flitterwochen in Prag musste Schiele Edith am 21. Juni in einem Prager Hotel zurücklassen und sich seinem Regiment anschließen. Die 21 Jahre junge Frau war nie zuvor allein gewesen und fand es sehr schwer, die längere Abwesenheit ihres Mannes zu ertragen. Sie berichtete in ihrem Tagebuch – das sie von Egon ursprünglich als Skizzenheft bekommen hatte und das sie seit der Hochzeit führte – unter anderem von unerträglicher Einsamkeit.
Ediths wechselnde Stimmungslagen, die vornehmlich auf die anhaltende Einsamkeit zurückgingen, führten Egon dazu, sich mit menschlicher Nähe in einer Weise auseinanderzusetzen, die für ihn bisher völlig unbekannt war. Er wurde in seinen Porträtzeichnungen empfänglich für jede ihrer flüchtigen Stimmungen, die er mit großer Einfühlsamkeit festhielt.
Die Bildnisse von Edith, die ab 1914 entstanden, markieren eine neue empathische Haltung, die auch in anderen Porträtarbeiten zu finden ist. Schieles später Erfolg als einfühlsamer Porträtist war zum Teil auf den persönlichen Reifeprozess zurückzuführen.
„Es war eine gute Idee von Dir, dieses Buch mitzunehmen, daß ich hier schreiben kann, beruhigt mich sehr […]. Ich werde dieses Buch nicht Tagebuch heißen, – sondern Trostbuch.“
Edith Schiele im Gedanken an Egon Schiele, Tagebuch, 23. Juni 1915
Porträts
Vergleicht man Schieles einziges bekanntes Selbstporträt als Soldat mit einer Selbstdarstellung von 1910, wird der eklatante Unterschied im Stil und Ausdruck augenscheinlich. Mit teils locker und kräftig eingesetztem Bleistiftstrich festgehalten, blickt uns im Bildnis von 1916 der ungewohnt realitätsnah porträtierte Künstler mit skeptisch-ernstem Blick entgegen, die Stirn leicht gerunzelt und die müden Augen schattig unterlegt – keine Spur von Pose oder expressionistischen Verzerrungen, wie sie in seinen frühen Arbeiten vorzufinden sind.
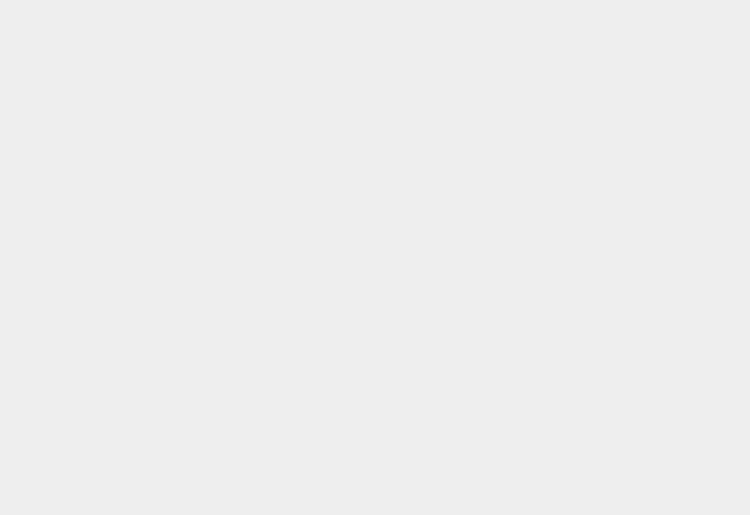 Egon Schiele, Zerfallende Mühle (Bergmühle), 1916 © Landessammlungen Niederösterreich | Foto: Landessammlungen NÖ
Egon Schiele, Zerfallende Mühle (Bergmühle), 1916 © Landessammlungen Niederösterreich | Foto: Landessammlungen NÖ
Im Juni 1916 – in diesem Jahr entstanden kriegsbedingt nur neun Gemälde – hielt Schiele eine alte Mühle am Erlauffluss nahe Mühling in Niederösterreich, wo er stationiert war, in ungewohnt detailreicher und fast berichterstattender Sachlichkeit fest. Kurz später bezeichnete der Künstler diese Arbeit als seine „wahrscheinlich beste Landschaft“. Das Motiv kann zugleich bezeichnend für die Zeit gelesen werden: Analog zu den stürmischen Verhältnissen scheinen die kräftigen, aufgewühlten Wassermassen die marode Mühle zum baldigen Einsturz zu bringen. Die symbolische Darstellung von Vergänglichkeit, von Leben und Tod, aber auch von ständiger Erneuerung hält immer wieder Einzug in Schieles Schaffen.
Die weibliche Figur
Als Schiele im Februar 1917 in sein Wiener Atelier zurückkehrte und zusehends wieder Modelle greifbar waren, zeigen seine Arbeiten gegenüber früheren Werken auch in diesem Sujet eine deutliche stilistische Veränderung.
Die Figuren sind eindeutig plastischer geworden, weibliche Rundungen werden betont. Nun sind es „Körper, geschwellt vom Leben“, stellte der Maler Anton Faistauer über die späten Werke seines Freundes fest. Zudem demonstrierte Schiele sein sukzessiv gesteigertes Können in überlegten Körperhaltungen und perspektivischer Raffinesse. Einzelne erprobte Posen wie hockende, liegende, stehende oder gebückte Haltungen wurden mehrmals aufgegriffen, verfeinert und optimiert.
Auch der Umgang mit Farbe in den Blättern ab 1914/15 betont Schieles Interesse an Plastizität. Die Haut ist nun häufiger differenzierter ausgearbeitet.
Erfolg und letzte Werke
Zurück in Wien war Schiele entschlossen, eine künstlerisch führende Rolle zu übernehmen und war voller Tatendrang. Zusehends stellten sich Erfolge ein. Am bedeutendsten war, dass er mit der Organisation der 49. Ausstellung der Wiener Secession im März 1918 betraut wurde.
Danach nahm sein Ruhm rasant zu. Der wachsende Erfolg brachte ihn mit kulturellen Größen in Kontakt, von denen er einige in Porträts festhielt. Schieles Linie war fließender geworden: Mit unglaublicher Sicherheit gelang es ihm, die Nuancen einer Pose in einem fast ununterbrochenen Strich festzuhalten und zugleich die Dreidimensionalität des Körperlichen einzufangen.
Schieles Fähigkeit, die menschliche Psyche zu verstehen und darzustellen – unabhängig von Geschlecht und Alter der dargestellten Person –, zählt zu den wichtigsten Errungenschaften seiner letzten Lebensjahre.
Projekt: Allegorischer Lebenszyklus
In seinen letzten beiden Lebensjahren begann Schiele auch mit einem Zyklus allegorischer Aktdarstellungen, die er in einem eigens dafür errichteten Mausoleum präsentieren wollte. Der Zyklus für das Mausoleum, der die großen Themen des irdischen Daseins, des Todes und der Auferstehung behandeln sollte, war sowohl eine Zusammenfassung der lebenslangen spirituellen Auseinandersetzungen des Künstlers als auch ein Versuch, die menschlichen Verluste des Ersten Weltkrieges zu verarbeiten.
Schiele lebte nicht lange genug, um seinen Mausoleum-Zyklus ausführen zu können, und die erhaltenen, teils unvollendeten Gemälde geben nur einen vagen Hinweis darauf, in welche Richtung er möglicherweise gegangen wäre. Seine letzten Werke zeigen eine Verquickung aus Realismus und Expression, Spiritualität und Sachlichkeit. Der Schriftsteller Hermann Menkes schrieb 1918: „[Schiele] malt die Kraft und das Hinfällige, das Ausgebrannte in den Seelen wie das Emporblühende. Er ist nüchtern und ekstatisch, ein Realist und ein Träumer.“