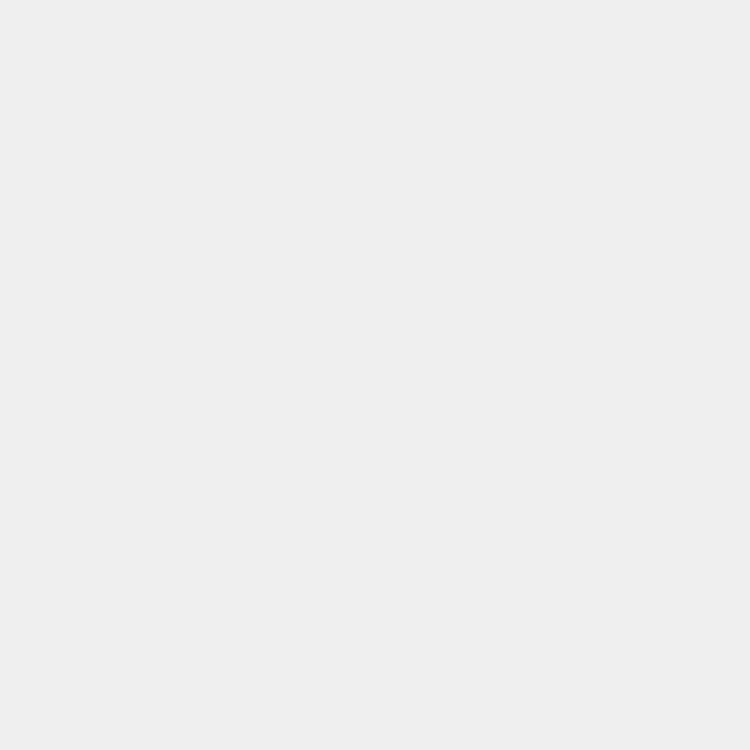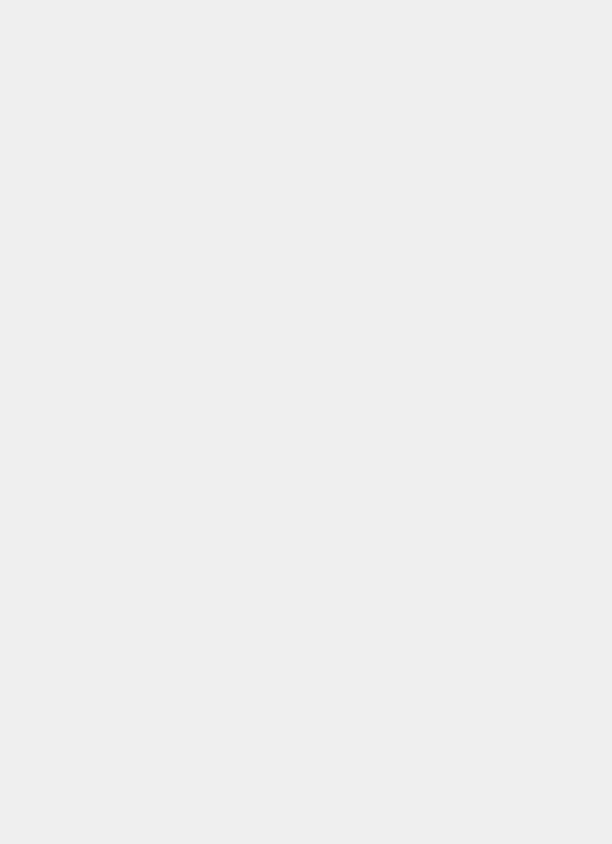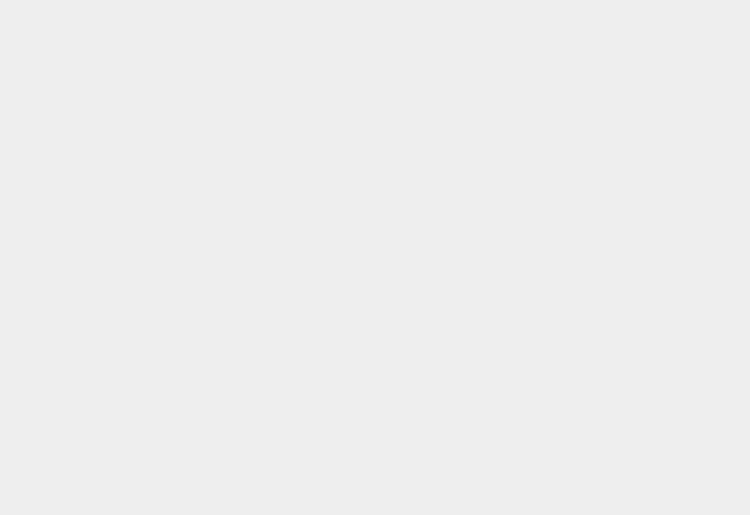KOLOMAN MOSER, Plakat für die XIII. Ausstellung der Wiener Secession, 1902 © Leopold Privatsammlung, Foto: Leopold Museum, Wien
Wiener Geschichten
Eine Sprache,
die alle verstehen
Leopold Museum Blog
Egon Schieles schulische Leistungen sind gelinde gesagt nur mäßig befriedigend. Nicht zuletzt deshalb wird er vom Gymnasium in Krems nach Klosterneuburg überwechseln. Allein: Die Noten werden nicht nennenswert besser werden. Das einzige, womit der Junge brilliert, ist sein überbordendes zeichnerisches Talent. Dafür haben die Lehrer einen geschulten Blick. Der Strich ist sicher. Die aquarellierten Landschaftsdarstellungen zeugen von Fertigkeit und Übung. Und so erfährt der junge Schiele sehr früh Bestärkung und Anerkennung. Selbst als sein Vater Adolf Leopold Schiele früh an den Folgen einer Syphilis-Infektion verstirbt und die Familie in Armut zurücklässt – kurz vor seinem Tod in der Silvesternacht 1904-1905 hatte Schieles Vater, der als Bahnhofsvorsteher in Krems zu den Gutverdienenden gezählt hatte, in einem paranoiden Schub die als Sicherheit für die Familie erstandenen Aktien im Ofenfeuer verbrannt – setzt sich der 16-jährige Egon mit seinem Wunsch, Maler zu werden, gegen den Widerstand der Familie durch. Marie Schiele, Egons Mutter, hatte den Wunsch geäußert, der noch minderjährige einzige Sohn möge zum Familieneinkommen beitragen. Auch der angeheiratete Onkel Leopold Czihaczek, der Egon und seine jüngere Schwester Gertrude finanziell unterstützt, ist skeptisch, wird Egon letztlich aber angesichts seines überzeugenden Talentes zugestehen, als jüngster Hörer seines Jahrganges an die Akademie der bildenden Künste zu gehen. Nur drei Jahre bleibt Egon an der altehrwürdigen Ausbildungsstätte. Dann überwirft er sich mit seinem Professor Christian Griepenkerl – den er als Vertreter einer völlig überholten, veralteten und nicht mehr zeitgemäßen Kunstauffassung verachtet – und etabliert sich als ehrgeiziger, nach neuen Lösungen strebender Künstler ohne Abschluss seines Studiums.
Auch Gustav Klimts Lehrer hatten dessen herausragende Fähigkeit, die Welt zeichnend zu erfassen, früh erkannt. Als diese seinen Vater, den Graveur Ernst Klimt Senior, in die Schule kommen lassen um ihm mitzuteilen, Gustav sollte an die Akademie geschickt werden, muss Klimt Senior abwinken: Die wechselnde Auftragslage und die zuweilen drängenden und quälenden wirtschaftlichen Verhältnisse, die Ernst Klimt den Älteren und seine Frau Marie zwingen, mit ihren sieben Kindern des Öfteren in Einzimmerwohnungen unter prekären Wohnbedingungen zu hausen, bieten nicht den nötigen finanziellen Spielraum, einem hochtalentierten Sohn die Ausbildung zum Maler an der ehrwürdigen Akademie der bildenden Künste zu ermöglichen. Glücklicherweise wird Gustav mit einem Stipendium ermöglicht werden, an der Kunstgewerbeschule des k. k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie – die heutige Universität für angewandte Kunst – gemeinsam mit seinem Bruder Ernst Klimt dem Jüngeren die Chance auf eine hervorragende Ausbildung zu bekommen. Der Bedarf an jungen hochtalentierten Künstlern, die dazu in der Lage sind, die neu errichteten Gebäude in der Donaumetropole – vor allem die Stadtpaläste der Bourgeoisie und die offiziellen Gebäude des Kaiserhauses – innen und außen mit qualitätsvoller Dekoration zu versehen, ist enorm. Nicht zuletzt deshalb wurde die dem k. k. Österreichischen Museum für Kunst und Industrie als neuem Institut nach britischem Vorbild der Arts and Crafts-Bewegung angeschlossene Ausbildungsstätte implementiert.
Wieso haben die Lehrer*innen Kakaniens – wie Robert Musil die österreichisch-ungarische Donaumonarchie als Königreich und Kaisertum einst bezeichnen sollte – die Fähigkeit, das zeichnerische Talent ihrer Schüler*innen früh zu erkennen, zu fördern und deren Fähigkeit, mit gezogener Linie ein Bild der Welt zu entwickeln, wertzuschätzen? Was befähigt die Pädagog*innen dieses großen, unüberschaubaren und heterogenen Reiches, das von Tendenzen des politischen Zerfalls, von nationalistischen Abspaltungsbewegungen und einem überholten und morbiden gesellschaftspolitischen System durchdrungen ist, dazu, grafische Talente ihrer Schüler*innen zu erkennen, zu benennen und zu fördern?
Das wochenstundenstärkste – und somit bedeutendste – Schulfach im gesamten Reichsgebiet der Donaumonarchie war „Freihandzeichnen“. Erst danach kamen Fächer wie Mathematik, Darstellende Geometrie, Nationalsprache und Deutsch als offizielle gemeinsame Schriftsprache des großen Reiches. Die Schüler*innen wurden gelehrt, alles, was sie umgibt und was sie sehen, zeichnerisch zu erfassen und sich durch den kognitiven Prozess des Zeichnens der sie umgebenden Welt zu bemächtigen. Dazu wurde den jungen Menschen ein Werkzeug in die Hand gegeben, das selbst minder talentierten Schüler*innen die Chance bot, sich ein Bild von allem was der Darstellung wert erscheint zu machen: Die Kinder und Jugendlichen wurden ermächtigt, unter Einsatz der geometrischen Grundformen – also unter Nutzung von Kreis, Dreieck und Rechteck – alle sie umgebenden Dinge im Geiste zu zerlegen um sie zeichnend aus den Grundformen zusammengesetzt darstellen zu können.
Das geniale Konzept stammt von dem deutschen Philosophen Johann Friedrich Herbart (1776–1841), der heute als Begründer der modernen Pädagogik bezeichnet wird. Er entwickelte die Methode, um Kindern über den Erkenntnisprozess des analytischen Zerlegens und Zusammensetzens der Dingwelt unter Nutzung der geometrischen Grundformen die Möglichkeit zur Selbstermächtigung in die Hand zu geben.
Nach der Erschütterung der Revolution 1848 hatte das politische Establishment der Donaumetropole den Philosophen und seine Pädagogik als einende Kraft für das habsburgische Reich erwählt und begonnen, sich seiner Potenziale zu bedienen.
„Machen, dass der Zögling sich selbst finde, als wählend das Gute, als verwerfend das Böse: dies oder nichts ist Charakterbildung!“
Johann Friedrich Herbart
Bis in die letzten Winkel des Habsburgerreiches kontrollieren die Landesschulinspektoren, ob die Lehrer*innen aller Schulstufen – in der Grundschule, in der Bürgerschule, die heutige Neue Mittelschule, und im Gymnasium – nach den einheitlichen Lehrplänen vorgehen um die Kinder und Jugendlichen zu lehren, sich zeichnend ein Bild von allem was sie umgibt zu machen, indem sie all dieses erfassen und es in geometrische Formen gießen – zugleich eine Strategie der Selbstermächtigung und der nonverbalen Kommunikation! Wie ein Uhrwerk funktionierte der gigantisch große Beamtenapparat der Monarchie Kaiser Franz Josefs I. und sorgt für Einheit: Alle Kinder der Donaumonarchie lernen sich über die Sprache der Form, über die gezogene Linie auszudrücken. Wen wundert, wenn Lehrer*innen dieses großen Reiches ihren Blick auf künstlerische, bildnerische Fähigkeiten so weit geschärft haben, dass sie mit erstaunlicher Treffsicherheit Karrieren zukünftiger Maler vorhersehen. Und so wundert auch nicht, dass Künstler, die in diesem Selbstverständnis einer nonverbalen Sprache sozialisiert worden waren, mit großer Souveränität auf genau dieses Vokabular zurückgreifen, um die Bildende Kunst zu reformieren, eine neue Ästhetik zu entwickeln. Statt üppiger Pracht treten nun Klarheit und der Anspruch konstruktiver Schönheit. Ganze Gebäude werden aus dem Baukasten Geometrie entwickelt und von strenger Eleganz getragen errichtet. Josef Hoffmann, Koloman Moser, Otto Prutscher werden zu Vertretern der konsequenten Idee des Gesamtkunstwerks. Ganz gleich ob Blumenvase, Teekanne oder Aschenbecher: Rechteck, Kreis und Dreieck sind Ausgangspunkt und einende Größe eines neuen Selbstverständnisses. Die Wiener Werkstätte erträumt eine verbesserte Welt durch Schönheit für alle. Allein sich dieser Manifestationen eines strikten Vokabulars und seiner Ästhetik in allen Bereichen der alltäglichen Lebensrealität zu bedienen, war weitgehend den Vertreter*innen der wohlhabenden Oberschicht vorbehalten. Für die Majorität der Bürger*innen der Donaumonarchie waren derartige Extravaganzen nicht erreichbar. Und doch: Das Rote Wien beauftragte im Sinne einer egalitären Idee der Formkunst verpflichtete Architekten mit der Gestaltung von Gemeindebauten und gewährleistete damit, dass tatsächlich eine tiefgreifende Verbesserung der Lebensrealität mittels qualitativ höchstwertiger Gestaltung und der Idee von Schönheit im Alltäglichen einherging. Auch der Antipode der Idee des Gesamtkunstwerkes, Adolf Loos, bediente sich geometrischer Stringenz.
„Dies Erhebung zur selbstbewußten Persönlichkeit soll ohne Zweifel im Gemüte des Zöglings selbst vorgehen und durch dessen eigene Tätigkeit vollzogen werden; es wäre Unsinn, wenn der Erzieher das eigentliche Wesen der Kraft dazu erschaffen und in die Seele eines anderen [Vorgaben/Regeln] hineinflößen wolle.“
Johann Friedrich Herbart: Über die ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung,1804, zitiert nach: Dietrich Benner: Johann Friedrich Herbart. Systematische Pädagogik, Weinheim 1997, S. 49.
Johann Friedrich Herbart hatte sich ausdrücklich gegen einen autoritären Erziehungsstil gestellt. Er forderte, die Schüler*innen durch „Aufforderung zur Selbsttätigkeit“ zu ermuntern. Lehrer*innen sollten die Rolle von Unterstützer*innen übernehmen, welche die Schüler*innen durch Denkanstöße zu Erkenntnisgewinn bringen sollten. Herbart war der Überzeugung, der eigentliche Lernprozess könne nur von den Schüler*innen selbst vollzogen werden. Eine an Modernität kaum zu überbietende Idee, die der Philosoph und Pädagoge in die Welt setzte und die wir heute mit dem Begriff der „Selbstermächtigung“ umschreiben würden.
Was trieb die Entscheidungsträger*innen der Donaumonarchie dazu? Wieso griffen sie auf das erstaunliche und revolutionäre Konzept eines deutschen Denkers der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück?
Wenn wir heute gern die Metapher des „Schmelztiegels“ bemühen, um die Gegebenheiten dieses Vielvölkerstaates zu umschreiben, so müssen wir auch die Schwierigkeiten benennen, die mit dem schier babylonisch zu nennenden Sprachengewirr einhergehen, das in diesem großen Reich geherrscht haben muss!
„Stil ist nichts Endgültiges, sondern beständiger Wandel.“
Walter Gropius
Seit der Annexion Bosniens und der Herzegowina 1908 war Österreich-Ungarn mit 676.000 km² nach dem Russischen Reich das flächenmäßig zweitgrößte und mit 52,8 Millionen Bürger*innen nach dem Russischen Reich und dem Deutschen Reich das bevölkerungsmäßig drittgrößte Land Europas. Sein Gebiet umfasste zuletzt – bis 1918 – die Territorien der heutigen Staaten Österreich, Ungarn, Tschechien , Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Teile des heutigen Rumäniens (Siebenbürgen, Banat, später Kreischgebiet, östlicher Teil von Sathmar, Südmarmarosch, Südbukowina), Montenegros (Gemeinden an der Küste), Polens (Westgalizien), der Ukraine (Ostgalizien, Karpatenukraine und Nordbukowina), Italiens (Trentino-Südtirol und Teile von Friaul-Julisch Venetien) und Serbiens (Vojvodina).
Dieser Heterogenität, der kulturellen und sprachlichen Buntheit und den immer wieder aufkeimenden Tendenzen und Bestrebungen zu nationalen Abspaltungen galt es, einende Kräfte und eine Erzählung kultureller Gemeinsamkeit entgegenzusetzen. Österreich-Ungarn bediente sich der Künste, um dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit zu kreieren.
„Wir müssen der Jugend mehr Gelegenheit geben, während ihrer Ausbildungszeit persönliche Erfahrungen zu machen. Nur wenn wir sie selbst Tatsachen finden lassen, kann Wissen zur Weisheit werden.“
Johann Friedrich Herbart
Bereits seit langem wird in dem habsburgischen Reich die Musik als nonverbales Medium des Austauschs, als einende Kraft, als metaphorische Sprache die jeder verstehen kann bemüht! Als erstes Monumentalgebäude der Wiener Ringstraße wird 1860 das neue Gebäude der k. k. Hofoper ausgeschrieben, dessen Errichtung aus dem neu gegründeten Wiener Stadterweiterungsfonds bestritten werden wird. Mit dem Bau des nach Plänen der Architekten August Sicard von Sicardsburg und Eduard van der Nüll im Stil der Neorenaissance entworfenen Musik-Tempels wird bereits ein Jahr später begonnen. Acht Jahre danach weihen Kaiser Franz Josef und seine Gemahlin Kaiserin Elisabeth den prächtigen und doch von den Wiener*innen damals nicht sehr geschätzten Musiktheaterbau ein.
Nach der dekorativen, ornamentalen Strenge in Gustav Klimts secessionistischer Kunst werden sich junge Künstler wie Egon Schiele mit großer Souveränität des Vokabulars der Formkunst bedienen. Neben Wien ist vor allem Prag eine Hochburg der konstruktiven Strömung: Antonín Procházka, František Kupka, Bohumil Kubišta, Josef Čapek, Otto Gutfreund und Erika-Giovanna Klien und viele andere Vertreter*innen der Avantgarde werden die geometrischen Grundformen – Kreis, Dreieck und Rechteck – in ihren Werken förmlich durchdeklinieren. Die Formkunst als einende Sprache, die dazu beitragen sollte, nationale Gräben zu überbrücken, hatte die Katastrophe des ersten Massenvernichtungskriegs der Menschheitsgeschichte nicht verhindern können: Auf den Ersten Weltkrieg folgte der Zweite. War es nicht das Versagen der Diplomatie – einhergehend mit von Pathos überlagerter Sprachlosigkeit, welches derartig fatale Folgen zeitigte? Die Konsequenzen waren der nationalsozialistische Irrwitz mit all seinen humanitären Verwerfungen, Krieg und Massenmord.
Und doch: Das Vokabular der Formkunst feierte einen internationalen Siegeszug! Der Kubismus George Braques und Pablo Picassos kann als konsequente Weiterentwicklung einer großen Idee hinein in die Moderne verstanden werden. Aber auch die Entwicklung des zeitgenössischen Begriffs des Design von der Wiener Werkstätte hin zum Bauhaus in Weimar und Dessau ist ohne Johann Friedrich Herbarts Erfindung eines pädagogischen Konzeptes nicht denkbar. In den USA wird die Vertreibung unzähliger Bauhaus-Künstler*innen wie Josef und Anni Albers durch die Nationalsozialisten zu einem Export und einer Verbreitung der Bauhauskultur über dem großen Teich führen. Josef Albers‘ Lehrtätigkeit am Black Mountain College in North Carolina gemeinsam mit Alexander Schawinsky führt dazu, dass Generationen von Vertreter*innen der Moderne den Einsatz der geometrischen Grundformen als Grundlage ihres Schaffens verstehen werden.
Und auch die Formsprache des Russischen Konstruktivismus bediente sich dieses Vokabulars. Die Sprache der Formkunst war weltumspannend geworden – jede*r kann sie verstehen. Wäre die Rückbesinnung auf eine Verbesserung der Welt durch Schönheit und Nutzung der geometrischen Formen vielleicht eine Chance als Beitrag zum Weltfrieden? In Tagen des aktuellen Krieges mitten in Europa klingt dies wohl unerträglich naiv und weltfremd. Aber sollten wir nicht trotz aller Verwerfungen, Aussichtslosigkeit und berechtigten Befürchtungen weiterhin versuchen, von Frieden zu träumen und an die positiven Kräfte künstlerischen Ausdrucks fest zu glauben?
Beitrag von Markus Hübl